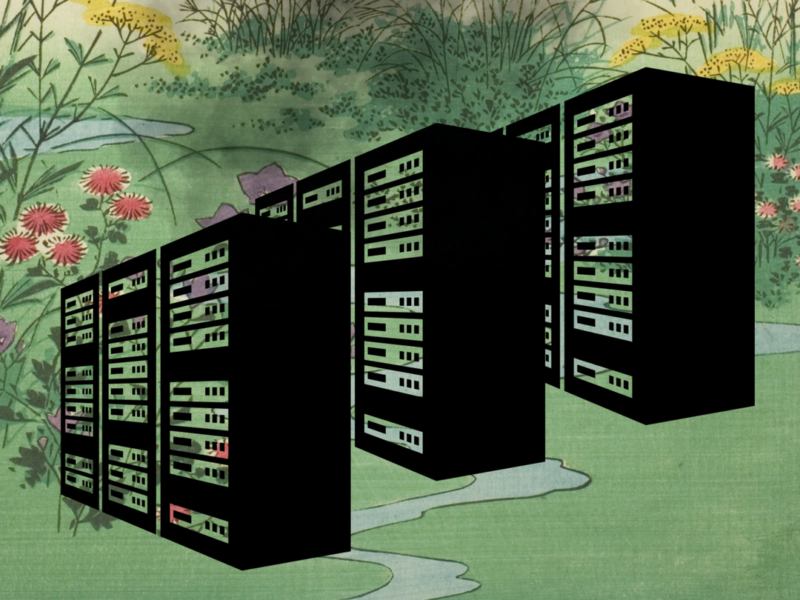Bis zum Jahr 2020 hätte dieser Artikel wahrscheinlich ein bedächtiges Nicken ausgelöst, aber nicht viel mehr. Dann kam die Pandemie und warf ein Schlaglicht auf zwei Tatsachen: Dass digitales Lernen eine wesentliche Kulturtechnik des 21. Jahrhunderts ist – und dass die föderale Bildungspolitik das gründlich verschlafen hat.
2020 brauchten aber alle ganz schnell digitale Klassenzimmer, Videokonferenzen, Einreichungs-Portale für Hausarbeiten und Foren-Software für Klassen und Seminargruppen. Im Aufhol-Aktionismus passierte und passiert nun das, was bei eiligen Lösungsversuchen oft geschieht: Es werden nicht alle mitgenommen. Das ist bei genauerem Nachdenken erstaunlich. Denn in der analogen Welt ist möglicherweise schneller eine Leiter hingestellt als ein Aufzug gebaut – aber im Digitalen ist es absurd, Menschen auszuschließen, nur weil sie anders wahrnehmen, länger zum Verstehen brauchen, oder eine Maus für sie ungeeignet ist. Online-Lernen an Schulen, Universitäten und Betrieben strotzt heute vor Barrieren. Keine davon müsste sein. Wie sind wir hier hin gekommen? Dazu müssen wir eine Zeitreise durch die 1990er und 2000er Jahre machen.
Das Web: Eine Spitzenidee
Digitale Daten haben eine fantastische Eigenschaft: Sie können eine Idee von ihrer Darstellung trennen. Das klappte vorher bei einem Schauspiel oder Musiknoten auch ganz gut, die erst lebendig werden, wenn sie jemand vorspielt. Aber zum Beispiel eine Blockflöte aus dem Thingiverse, die als digitaler 3D-Modell-Datensatz vorliegt, lässt sich auf viele Weisen darstellen:
- Als digital erzeugtes 2D-Bild,
- als auf dem Bildschirm drehbares 3D-Modell,
- als betastbarer 3D-Druck,
- und natürlich als Blockflöten-Klang beim Spielen.
Bei den HTML-Seiten, aus denen das World Wide Web besteht, funktioniert es ähnlich. Im Kern sind es Text-Daten, aber sie bringen Zusatz-Informationen mit, was die Teile des Textes zu bedeuten haben. Das eine ist eine Überschrift, das andere ein Textabsatz, hier eine Auflistung, dort ein Zitat, dazu Bilder oder Eingabefelder. Ob das Dokument dann am Bildschirm angezeigt, vorgelesen, als Buch gedruckt oder auf einer Braille-Zeile ertastet wird, ist den Daten völlig egal.
Diese schon damals nicht neue Idee (der Fachbegriff ist „semantische Auszeichnung„) machte das junge Web im Handstreich barrierearm. So betrat zeitgleich mit Amazon oder ebay zum Beispiel der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband e. V. in den frühen 2000ern die Internet-Bühne, und klärte sofort über die zugängliche Gestaltung von Webseiten auf. Für einen Moment sah es nach einer schönen neuen Welt aus.
Profit und Ignoranz
Es ist heute schwer vorstellbar, aber bis in die 1990er Jahre hinein war das Internet – damals immerhin schon um die 20 Jahre alt – ein streng nicht-kommerzieller Raum. Die US-amerikanische „National Science Foundation“ wachte argwöhnisch darüber, dass vom Internet kein „nicht akzeptabler Gebrauch“ gemacht wurde, und das hieß für sie: Online wird nichts gekauft und verkauft.
Das änderte sich Mitte der 1990er Jahre, unter anderem durch gesetzliche Deregulierung. Die Folge war ein digitaler Goldrausch. Es schien, als ob alle, die eine Internetseite einrichten konnten, plötzlich irgendwas im Internet verkaufen wollten. Und wer keine Seite hatte, war für viele schlichtweg nicht mehr bedeutsam. Die Idee erwies sich als Blase, die schnell platzte: 2002 war der Rausch wieder vorbei und unvorstellbare 5 Billionen Dollar Investitionen in all die neuen Verkaufsseiten hatten sich in Luft aufgelöst. Die Folgen aber prägen das Web und damit auch das Online-Lernen bis heute.
Übrigens war der Schauplatz des Ganzen überwiegend die USA. Die Bundesrepublik hatte das Internet verpennt, Bund und Länder betrieben bis 2001 lieber das in den 1970ern entwickelte BTX. Für den Zugriff aufs Internet mussten sich die Menschen mühsam über die Telefonleitung einwählen, während es in den USA schon schnellen Dauerzugang über Fernsehkabel gab.
Im Rausch der sogenannten „Dot-Com-Blase“ ging es jedenfalls darum, möglichst vielen Menschen online etwas zu verkaufen. Kleidung, Bücher, Tonträger, Spielzeug, Gebrauchtwaren oder Internetdienste wie soziale Netzwerke und Suchmaschinen. Die Kalkulation war simpel: Mit engagiertem, aber am Ende überschaubaren Aufwand sollten so viele zahlungskräftige Menschen wie möglich erreicht werden. Das geschah mit genau der Technik von HTML-Seiten, die grundsätzlich barrierearm zugänglich sind. Jetzt aber wurden sie Grafikdesigner*innen in die Hand gegeben, die zwar einiges von Photoshop, aber nichts von Barrierefreiheit wussten – und die rasend schnell Seiten für die Mehrheit der Menschen bauen sollten, und das hieß in ihrer Vorstellung: für Menschen ohne Behinderung.
Menschen mit Einschränkungen sind für die kapitalistische Logik nur interessant, wenn sie Geld in die Kasse bringen. So lassen sich an Menschen mit leichten Seh-Einschränkungen ausgezeichnet Designer-Brillen verkaufen. Auch für Medikamente gegen Alterserscheinungen gibt es einen riesigen Markt. Menschen mit Lernschwierigkeiten wiederum haben in dieser Denkweise keine Kaufkraft zu bieten. Und unter Gutverdienenden mögen auch Menschen mit Hörbehinderung sein, sie sind als Zielgruppe aber viel zu klein, um speziell ihnen im frühen World Wide Web ein Angebot zu machen.
Das alles führte dazu, dass „Webdesign“ seit dieser Zeit, also fast einem Vierteljahrhundert, gleichbedeutend ist mit „Design für Menschen ohne Einschränkungen“. So wurde es eingeübt, und so wird es seitdem in Firmenabteilungen und in Ausbildungen weitergegeben. Wenn jemand heute eine neue Internetseite veröffentlicht, geht es fast immer darum „Wieviel kann ich damit verdienen?“, und fast nie um „Wie kann ich damit alle Menschen erreichen?“
Und deshalb haben wir jetzt Nachrichtenseiten, Videoplattformen, Kurznachrichtendienste, soziale Netzwerke, Streaming-Anbieter, Wetterdienste und Versanddienstleister, die behinderte Menschen kaum berücksichtigen oder sogar ausschließen – und genau da reiht sich Online-Lern-Software ein. Die ist nämlich kein Sonderfall, sondern heute ganz wesentlich auf kommerzielle Firmen-Schulungen zugeschnitten, weil auch sie Geld einnehmen soll.
Und wie wird das jetzt besser?
Eines ist klar – der Kapitalismus wird sich nicht um Menschen mit Einschränkungen kümmern. Es ist also nicht damit zu rechnen, dass wir nur warten müssen, und plötzlich kommt eine grandiose inklusive Online-Lern-Software auf den Markt. Das müssen also zwei andere mächtige Akteur*innen aufräumen: Der Staat und die Zivilgesellschaft.
Der Bund, die EU und Staaten weltweit könnten noch viel mehr für Menschen mit Behinderung tun. Aber es ist nicht so, dass sie das Thema nicht auf dem Schirm hätten. Die „Erklärung über die Rechte der behinderten Menschen“ gibt es seit den 1970ern, seit 2002 bereits die bundesdeutsche „Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung“, seit 2006 die UN-Behindertenrechtskonvention. Der Staat bewegt sich langsam, aber er bewegt sich, staatliche Stellen sind inzwischen zur Barrierefreiheit verpflichtet. Das entfaltet langsam, aber stetig eine Wirkung in die Breite, denn um Internetdienste für Bund und Länder bauen zu dürfen, müssen Gestalter*innen sich jetzt mit Barrierefreiheit auseinandersetzen, ob sie wollen oder nicht. Und dieses Wissen vergessen sie danach ja nicht.
Auf der zivilgesellschaftlichen Seite kommt es auf genau die Leute an, die sich denken: Hä? Wieso bauen wir denn Barrieren in digitale Technologie rein, obwohl das gar nicht sein muss?
Denn dann entstehen gute Open-Source-Projekte.
- Über 1000 Freiwillige bauen den Dark Reader, der Internetseiten in einen dunklen Modus schalten kann, auch wenn sie ursprünglich gar nicht dafür vorgesehen waren.
- Die Blog-Software WordPress kümmert sich überall um Barrierefreiheit und hat dafür ein eigenes Team, dessen Ziel Konformität zum Standard WCAG 2.1 auf Stufe „AA“ ist.
- Ein anderes großes Team hat den Screenreader NVDA programmiert, der weltweit auf allen Plattformen genutzt wird.
Und Lern-Management-Systeme (LMS)? Auch hier stammen viele, selbst wenn sie Open Source sind, aus der Zeit, in der Barrierefreiheit zwar nicht unbekannt, aber nicht die oberste Priorität und deshalb überwiegend eine Zusatz-Funktion war.
Seit der Förderrunde 13 vom Prototype Fund entsteht Luna LMS als ein Versuch, wie digitales Lernen von Anfang an barrierefrei gestaltet werden kann. Der Grundgedanke von Luna will zurück zu dem Charme von digitalen Daten, wie oben erklärt: Die Darstellung sollte sich den Bedürfnissen der Menschen anpassen, und nicht umgekehrt. Und Redakteur*innen sollten deutliche Hinweise bekommen, wenn ihre Inhalte für einige Menschen (noch) nicht funktionieren. Das Ziel ist universelles Design anstatt halbherziger nachgeschobener Zusatz-Funktionen für Menschen mit Einschränkungen.
Luna LMS ist noch ganz jung, aber es ertastet einen neuen Weg, den die Vorgänger-Programme nicht ausprobiert haben. Wenn ihr die Reise mitverfolgen wollt, könnt ihr das auf der Luna-Website und auf dem Mastodon-Konto von Luna tun.
Bekommen wir jetzt also doch die schöne neue Welt? Wir arbeiten zumindest dran. 🙂
Florian Berger schrieb bereits seine Diplomarbeit über effiziente Content-Management-Systeme. Neben seiner Arbeit als Softwareentwickler für Educational Games in verschiedenen Unternehmen und wissenschaftlicher Forschung zu Mediendidaktik ließ ihn die Web-Entwicklung nie ganz los. In Luna LMS fließen auch seine Erfahrungen als Hochschuldozent ein.